Einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause zu betreuen ist eine stille Heldentat, die häufig im Verborgenen geschieht. Tag für Tag begleiten, helfen, motivieren, trösten – wer sich dieser Aufgabe annimmt, verdient nicht nur Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung. Denn Pflege ist nicht nur eine emotionale, sondern auch eine körperliche und finanzielle Herausforderung.
Viele Familien entscheiden sich bewusst dafür, die Pflege eines nahestehenden Menschen selbst zu übernehmen – sei es aus Liebe, Pflichtgefühl oder dem Wunsch, dem Angehörigen ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Doch mit dieser Entscheidung gehen nicht selten Unsicherheiten einher: Welche Pflegeleistungen stehen einem eigentlich zu? Was ist ein Pflegeausgleich – und wie berechnen Angehörige diesen korrekt?
Inhalt des Beitrags
Welche Möglichkeiten gibt es als Pflegeausgleich für Angehörige?
Die tägliche Unterstützung bei der Körperpflege, beim Essen, bei Arztbesuchen oder organisatorischen Aufgaben bringt pflegende Angehörige oft an ihre Grenzen. Besonders wenn keine professionelle Hilfe zur Seite steht, ist die Belastung enorm: Nicht selten müssen Beruf und Pflege miteinander vereinbart werden, was zu Einkommensverlusten oder gar dem Verlust des Arbeitsplatzes führen kann.
Daher ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Pflegeausgleich auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht nur um emotionale oder körperliche Entlastung, sondern ganz konkret um finanzielle Leistungen, die als Ausgleich für geleistete Pflege dienen – und damit das private Engagement anerkennen.
Finanzielle Leistungen
Pflegende Angehörige leisten Tag für Tag einen unschätzbaren Beitrag – häufig unbezahlt. Damit sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben, gibt es verschiedene Formen der Unterstützung. Zu den wichtigsten gehören:
- Pflegeunterstützungsgeld: Eine Lohnersatzleistung für bis zu zehn Tage pro Jahr, wenn Angehörige aufgrund eines akuten Pflegefalls der Arbeit fernbleiben müssen. Sie beträgt 90 % des ausgefallenen Nettoentgelts.
- Zinslose Darlehen für Wohnraumanpassungen: Wer den Wohnraum barrierefrei umbaut – etwa durch den Einbau eines Treppenlifts oder rollstuhlgerechte Türen –, kann unter bestimmten Bedingungen ein staatlich gefördertes Darlehen erhalten.
- Verhinderungspflege: Falls die Pflegeperson verhindert ist, übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten für eine Ersatzpflege. Diese Leistung kann bis zu 1.685 Euro im Jahr betragen – oder bis zu 3.539 Euro, wenn Kurzzeitpflegeansprüche übertragen werden.
- Kurzzeitpflege: Für stationäre Entlastungsphasen steht ein Budget von 1.774 Euro pro Jahr zur Verfügung.
Unterstützungsangebote
Nicht jede Unterstützung muss finanzieller Natur sein. Es gibt eine Vielzahl an Angeboten, die Angehörige in ihrem Pflegealltag entlasten können:
- Beratungsdienste der Pflegekassen
- Pflegekurse, z. B. über den Medizinischen Dienst oder Wohlfahrtsverbände
- Selbsthilfegruppen, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen
- Ambulante Entlastungsleistungen, etwa haushaltsnahe Dienstleistungen oder Alltagsbegleiter
Diese Maßnahmen sind besonders wichtig, wenn die Pflege sich über viele Jahre zieht. Sie bieten emotionale und praktische Unterstützung – und helfen, eigene Ressourcen zu schonen. Reichen Kurzzeit- oder Verhinderungspflege nicht mehr aus? Wir prüfen mit Ihnen, ob 24-Stunden-Pflege zu Ihrer Situation passt und wie sich Leistungen wie Pflegegeld, Entlastungsbudget und Zuschüsse einbinden lassen.

Individuelle Betreuungslösung für Ihr Zuhause
Jede Situation ist einzigartig – wir helfen Ihnen, die passende Betreuungslösung zu finden. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen zur Seite und begleiten Sie auf dem Weg zur optimalen Pflegekraft. Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten.
Kostenlose Beratung sichernPflegekurse und Selbsthilfegruppen
Neben finanziellen Hilfen und organisatorischer Unterstützung spielen auch Informationen und Austausch eine zentrale Rolle im Alltag pflegender Angehöriger. Gerade wer ohne fachliche Vorkenntnisse in die Pflege eines nahestehenden Menschen hineinwächst, steht oft vor vielen Fragen – von der richtigen Lagerung über den Umgang mit Demenz bis hin zur rechtlichen Absicherung.
Hier bieten Pflegekurse, die von Pflegekassen oder Wohlfahrtsverbänden kostenlos angeboten werden, eine wertvolle Grundlage. Sie vermitteln praxisnahes Wissen und geben Sicherheit im Umgang mit pflegebedürftigen Angehörigen. Auch Online-Kurse sind inzwischen verbreitet – eine flexible Lösung, insbesondere für Berufstätige.
Zusätzlich dazu können Selbsthilfegruppen eine wichtige emotionale Stütze sein. Der Austausch mit anderen, die sich in ähnlichen Lebenssituationen befinden, schafft nicht nur Verständnis, sondern auch neue Perspektiven. Wer regelmäßig Erfahrungen teilt, erhält nicht selten auch ganz praktische Tipps – etwa zur Ausgleichungspflicht im Erbrecht oder zur Berechnung eines Pflegeausgleichs im Falle eines späteren Nachlasses.
Zeit für sich selbst
Pflegende Angehörige leisten Tag für Tag Unglaubliches – oft über viele Jahre hinweg. Dabei gerät die eigene Gesundheit nicht selten aus dem Blick. Doch nur wer sich selbst gut versorgt, kann langfristig für andere da sein. Daher ist es wichtig, regelmäßig Zeit für sich selbst einzuplanen. Das ist kein Egoismus, sondern notwendige Vorsorge.
Angebote wie die Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege ermöglichen es, für einige Tage oder Wochen Abstand vom Pflegealltag zu gewinnen. Gerade bei längerer Pflegezeit hilft eine solche Entlastung, neue Kraft zu schöpfen. Diese Leistungen gehören zum Spektrum gesetzlich verankerter Pflegeleistungen – und werden von der Pflegekasse unter bestimmten Voraussetzungen erstattet.
Tipp: Wer keine stationäre Lösung möchte, kann auch auf ambulante Entlastungsleistungen zurückgreifen – etwa durch einen stundenweisen Alltagsbegleiter oder haushaltsnahe Hilfe.
Was Angehörige häufig übersehen: Viele pflegende Angehörige wissen gar nicht, dass sie Anspruch auf Pflegeleistungen haben – selbst wenn sie keine professionelle Qualifikation mitbringen. Der Gesetzgeber erkennt die Pflege durch Angehörige ausdrücklich an und stellt sie unter bestimmten Bedingungen sogar besser als gewerbliche Anbieter.
Die Kurzzeit- und Verhinderungspflege als Pflegeausgleich
Die häusliche Pflege eines Angehörigen verlangt ständige Präsenz und Flexibilität. Umso wichtiger ist es, zeitweise Entlastung zu ermöglichen – ohne dass dabei die Versorgung der pflegebedürftigen Person leidet. Genau hier setzen Kurzzeit- und Verhinderungspflege an: zwei zentrale Bausteine des Pflegeausgleichs, die Angehörigen echte Pausen ermöglichen.
Die Kurzzeitpflege bietet eine vorübergehende vollstationäre Betreuung – zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt oder während einer Krisensituation. Bis zu acht Wochen pro Jahr können Angehörige diese Möglichkeit nutzen, um sich zu erholen oder dringende Verpflichtungen wahrzunehmen. Dabei wird das Pflegegeld für bis zu vier Wochen zur Hälfte weitergezahlt. Wird dieser Anspruch nicht genutzt, kann ein Teil der Mittel sogar für die Verhinderungspflege angerechnet werden – und die Gesamtleistung erhöht sich entsprechend.
Die Verhinderungspflege greift immer dann, wenn die Hauptpflegeperson krank ist, Urlaub nimmt oder aus anderen Gründen verhindert ist. Die Pflege kann dann von einem ambulanten Dienst oder anderen Angehörigen übernommen werden. Dafür stehen bis zu 1.685 Euro jährlich zur Verfügung – erweiterbar auf 3.539 Euro, wenn ungenutzte Kurzzeitpflege angerechnet wird.
Diese Leistungen sind ein Ausgleich für die kontinuierliche Verantwortung im Pflegealltag. Sie schützen pflegende Angehörige vor Erschöpfung – und leisten so einen Beitrag zur nachhaltigen Stabilität der gesamten Familiensituation.
Übrigens: Diese Unterstützungsform kann auch später im Rahmen eines Ausgleichsanspruchs unter Miterben thematisiert werden – etwa wenn der pflegende Abkömmling über Jahre hinweg auf Freizeit und Beruf verzichtet hat. In solchen Fällen sind Ausgleichszahlungen innerhalb der Erbengemeinschaft möglich – oft mit Verweis auf § 2057a BGB.
Welche Leistungen stehen Ihnen als Pflegeausgleich für Angehörige zu?
Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem festgestellten Pflegegrad. Zusätzlich spielt es eine Rolle, ob ausschließlich Geldleistungen, Sachleistungen oder eine Kombination bezogen werden. Auch der Wohnort kann die Höhe leicht beeinflussen.
Pflegegrade und Pflegegeld in Deutschland
| Pflegegrad | Voraussetzungen | Höhe des Pflegegeldes (pro Monat) |
|---|---|---|
| 1 | Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | Kein Pflegegeld, nur Sachleistungen |
| 2 | Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 347 Euro |
| 3 | Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 599 Euro |
| 4 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 800 Euro |
| 5 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 990 Euro |
Zusätzlicher Pflegeausgleich durch Rentenansprüche
Pflegende Angehörige erhalten nicht nur emotionale Anerkennung – auch ihre spätere Altersvorsorge wird vom Gesetzgeber berücksichtigt. Sobald eine pflegebedürftige Person mindestens Pflegegrad 2 hat, können unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung durch die Pflegekasse übernommen werden.
Voraussetzung dafür ist:
- Es werden mindestens 10 Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen geleistet.
- Die Pflege findet im häuslichen Umfeld statt.
- Die pflegende Person arbeitet nicht mehr als 30 Stunden pro Woche beruflich.
Kurz und knapp: Die Rentenbeiträge übernimmt die Pflegekasse. Sie bemessen sich anhand eines bundesweiten Durchschnittsgehalts und liegen je nach Pflegeaufwand zwischen 18,9 % und 100 % der Basis.
Wie hoch ist der Anspruch?
Die Höhe der Rentenversicherungsbeiträge richtet sich nach dem Pflegegrad und der Art der Pflegeleistungen (Geld-, Kombi- oder Sachleistung). Grundlage ist ein fiktives Einkommen, das jährlich durch die Bundesregierung neu festgelegt wird.
Aktuell (2025): Seit diesem Jahr gilt eine einheitliche Bezugsgröße in ganz Deutschland. Die zuvor getrennten Bemessungsgrundlagen für Ost und West (z. B. 3.535 €/3.465 € in 2024) wurden abgeschafft. Die neue Größe liegt – nach bisherigem Stand – bei etwa 3.570 € pro Monat.
Die Pflegekasse zahlt 18,6 % Rentenbeiträge auf Basis dieser Bemessung.
Rentenversicherungsbeiträge
| Pflegegrad | Pflegegeld | Kombileistung | Sachleistung |
|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | — | — | — |
| Pflegegrad 2 | 27 % | 22,95 % | 18,9 % |
| Pflegegrad 3 | 43 % | 36,55 % | 30,1 % |
| Pflegegrad 4 | 70 % | 59,5 % | 49 % |
| Pflegegrad 5 | 100 % | 85 % | 70 % |
Wer also einen Angehörigen mit Pflegegrad 5 ausschließlich zuhause pflegt und keine bezahlte Hilfe einsetzt, für den übernimmt die Pflegekasse die vollen Rentenbeiträge auf Basis des fiktiven Einkommens. So entsteht ein echter Pflegeausgleich – auch über die aktive Pflegezeit hinaus.
Tipp: Eine gute Dokumentation der Pflegetätigkeit kann später auch bei möglichen Ausgleichsansprüchen im Rahmen des Nachlasses relevant sein – insbesondere wenn es um die faire Aufteilung des Nachlasses unter Miterben geht.
Pflegeausgleich als Ausgleich für entgangenes Einkommen
Nicht alle Leistungen der Pflege lassen sich in Zahlen ausdrücken – doch finanzielle Einbußen durch reduzierte Arbeitszeit oder Berufsaufgabe gehören zu den spürbarsten Konsequenzen. Um diese zu kompensieren, sieht das Pflegesystem einen Pflegeausgleich auch in Form von Ausgleichszahlungen vor. Diese sollen pflegende Angehörige vor langfristigen Nachteilen schützen.
Wenn etwa ein Kind seine Berufstätigkeit einschränkt oder aufgibt, um einen Elternteil zu versorgen, entsteht in vielen Fällen ein konkreter finanzieller Verlust. Hier greifen sowohl staatliche Leistungen (z. B. Pflegeunterstützungsgeld, Rentenansprüche) als auch innerfamiliäre Regelungen – insbesondere im Erbfall.
Wichtige Voraussetzungen für einen Anspruch:
- die Pflege erfolgte überdurchschnittlich intensiv und über längere Zeit
- es bestand keine Vergütung oder Zuwendung als Ausgleich zu Lebzeiten
- die Leistung diente dem Vermögenserhalt oder der Entlastung der Erblasserin bzw. des Erblassers
Oft werden solche Ansprüche erst im Streit unter Miterben thematisiert – daher empfiehlt es sich, frühzeitig Klarheit zu schaffen. Wer pflegt, sollte Vereinbarungen schriftlich festhalten oder eine Pflegevereinbarung abschließen.
Pflegeausgleich im Erbrecht: Wann pflegende Angehörige mehr bekommen können
Pflege ist nicht nur eine Geste der Verbundenheit – sie kann im Erbfall auch rechtlich relevant werden. Wer über einen längeren Zeitraum einen nahestehenden Menschen gepflegt hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einen Ausgleich über den normalen Erbteil hinaus. Geregelt ist das in § 2057a BGB.
Demnach können Abkömmlinge, die sich besonders um den Erblasser gekümmert haben, eine Ausgleichszahlung gegenüber anderen Erben geltend machen – vorausgesetzt, die Pflege war überdurchschnittlich umfangreich und erfolgte unentgeltlich. Wichtig ist, dass die Leistungen zu einer Entlastung beigetragen oder den Erhalt des Vermögens des Erblassers gesichert haben.
Voraussetzung für den Ausgleichsanspruch:
- langfristige, intensive Pflege über das übliche Maß hinaus
- kein finanzieller Ausgleich oder Schenkung zu Lebzeiten
- die Pflege hat Kosten erspart oder Werte erhalten
Ein solcher Anspruch besteht nicht automatisch, sondern muss im Rahmen der Aufteilung des Nachlasses aktiv eingefordert werden. Gerade wenn mehrere Miterben beteiligt sind, kommt es schnell zu Diskussionen.
Tipp: Dokumentieren Sie den zeitlichen Umfang und die Art der Pflegeleistungen regelmäßig – das hilft später bei der Durchsetzung eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Erbrechts. Sie pflegen seit Längerem umfassend und möchten die Betreuung stabil organisieren? Wir erstellen Ihnen ein individuelles 24-Stunden-Pflege-Konzept und zeigen, welche Nachweise zur Pflegedokumentation im Alltag sinnvoll sind.
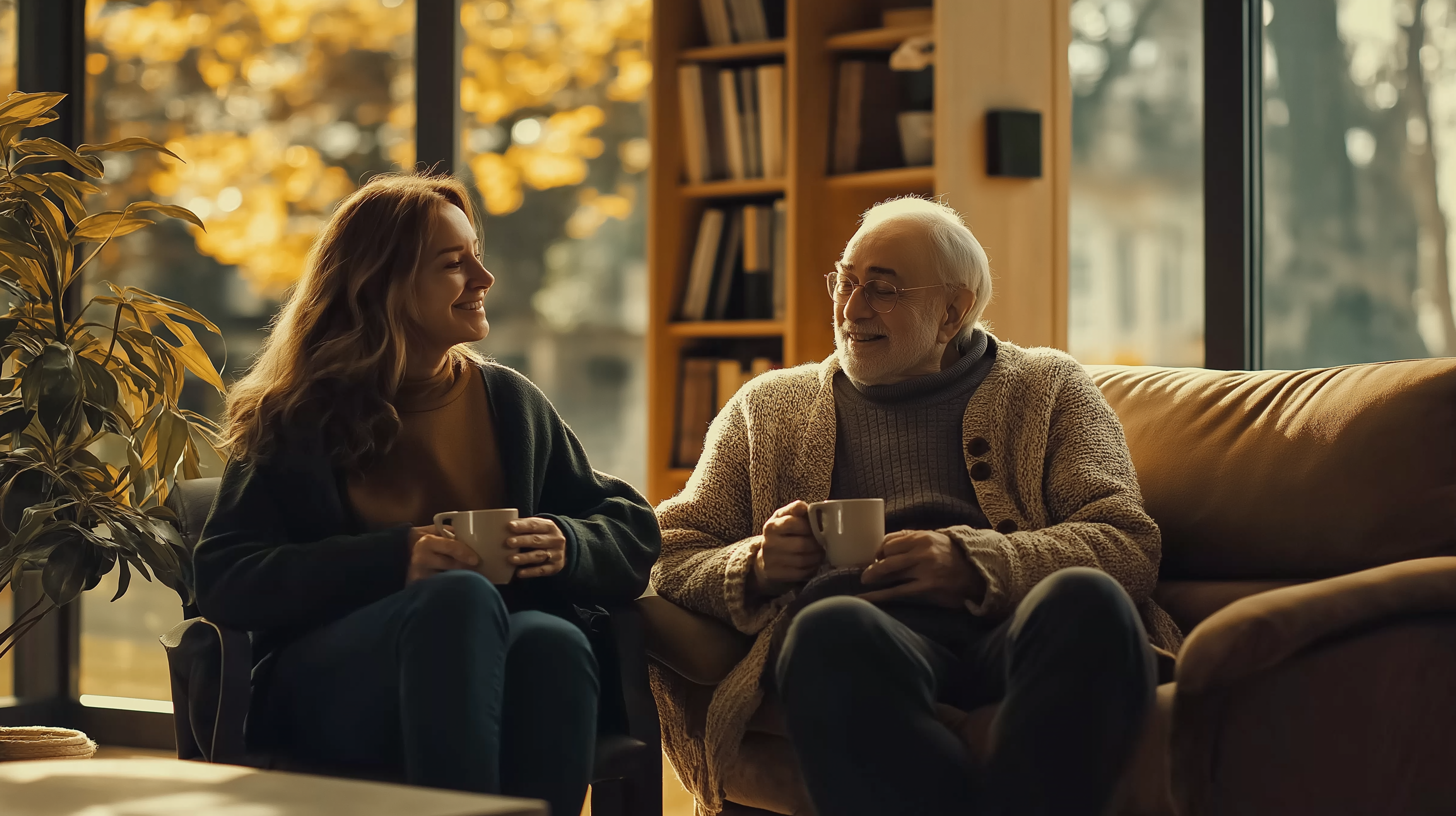
Ihre 24-Stunden-Pflege zu Hause
Suchen Sie eine vertrauensvolle 24-Stunden-Pflegekraft? Wir helfen Ihnen, die passende Betreuung für Ihre Angehörigen zu finden – individuell, liebevoll und kompetent. Entdecken Sie die Vorteile einer Betreuung in den eigenen vier Wänden – sicher, geborgen und ganz nach Ihren Wünschen.
Jetzt Pflegekraft findenFazit: Pflege anerkennen – Ausgleich sichern
Die häusliche Pflege eines Angehörigen ist mehr als ein Akt der Fürsorge – sie ist häufig ein jahrelanger Kraftakt. Zwischen Beruf, Familie und Verantwortung leisten Angehörige oft mehr, als nach außen sichtbar wird. Um diese Leistung angemessen zu würdigen, sieht das Pflegesystem in Deutschland verschiedene Pflegeleistungen vor: finanzielle Hilfen, Entlastungsangebote, Rentenansprüche – und langfristig auch Regelungen für einen gerechten Ausgleich im Erbfall.
Wer über längere Zeit einen nahestehenden Menschen pflegt, erbringt nicht nur emotionale Arbeit, sondern schützt oft auch aktiv das Vermögen des Erblassers – etwa durch den Verzicht auf professionelle Pflegedienste oder Heimunterbringung. Der Gesetzgeber trägt dem Rechnung: Mit § 2057a BGB wurde ein Instrument geschaffen, das pflegenden Erben eine Ausgleichszahlung im Rahmen der Aufteilung des Nachlasses ermöglicht. Diese Ausgleichsansprüche sind Ausdruck dafür, dass Pflege nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich Anerkennung verdient.
Pflegende Angehörige dürfen nicht länger zwischen Selbstaufopferung und Unsichtbarkeit stehen. Sie brauchen nicht nur Pausen und Unterstützung – sondern eine faire rechtliche Grundlage, um am Ende nicht leer auszugehen. Der Pflegeausgleich ist dabei kein Bonus, sondern eine notwendige und gerechte Anerkennung für jahrelangen Einsatz.








