Die Einstufung in einen Pflegegrad bildet die Grundlage dafür, welche Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden können. Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade (1 bis 5), die den Umfang der individuellen Pflegebedürftigkeit widerspiegeln und bestimmen, welche konkreten Hilfen einer Person zustehen. Je nach Einstufung erhalten Betroffene unterschiedliche Formen der Unterstützung – von kleineren Alltagshilfen bis hin zu umfassender Pflege – immer mit dem Ziel, die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten und die Selbstständigkeit so weit wie möglich zu fördern.
Inhalt des Beitrags
Die Klassifizierung der Pflegegrade und ihre Bedeutung für die Leistungsansprüche
Die Pflegegrade von 1 bis 5 sind für die Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversicherung ausschlaggebend. Doch wie werden diese Grade festgelegt und welche Leistungen und Hilfeleistungen werden von ihnen gedeckt?
Grundsätzlich gilt: Pflegebedürftige Menschen können einen Pflegegrad auf Antrag von ihrer Pflegeversicherung erhalten, der auch Pflegeleistungen beinhaltet. Die Grade 1 bis 5 reflektieren den Grad der Pflegebedürftigkeit und geben an, welche Leistungen und Hilfestellungen die pflegebedürftige Person zur Unterstützung ihrer Selbstständigkeit erhalten kann. Pflegebedürftigkeit tritt ein, wenn eine Person aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen, die häufig durch das Alter bedingt sind, dauerhaft nicht fähig ist, den Alltag eigenständig zu meistern und daher auf die Hilfe oder Pflege anderer angewiesen ist.Definition: Pflegebedürftigkeit
Unter Berücksichtigung von Umständen wie chronischen Erkrankungen, Alterungsprozessen, Unfällen oder akuten Erkrankungen muss die Pflegebedürftigkeit auf Dauer bestehen, um Leistungen von der Pflegekasse zu erhalten. Gutachter nutzen dazu einen umfangreichen Fragenkatalog, der die Beeinträchtigung des pflegebedürftigen Menschen in den Bereichen körperlich, psychisch und geistig bewertet.
Die Schwere der Pflegebedürftigkeit bestimmt die Einstufung in einen Pflegegrad und somit die Leistungen, die Betroffene aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen können. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Unterstützung und Leistungen stehen zur Verfügung.
Die fünf Pflegegrade
- Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit
- Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit
- Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit
- Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit
- Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
Der Grad der Selbständigkeit ist ausschlaggebend für die Zuordnung eines Pflegegrades. Der Gutachter gibt hierzu eine Stellungnahme ab und bewertet, wie selbständig die pflegebedürftige Person ihr Leben führen kann.
Dabei fließen elementare Dinge wie Körperpflege oder Essen und Trinken sowie geistige Fähigkeiten und die Pflege sozialer Kontakte mit ein. Wichtig ist zudem, dass die Pflegebedürftigkeit dauerhaft besteht.
Ein wichtiger Schritt zur passenden Unterstützung
Egal, ob geringe Einschränkung oder Rund-um-die-Uhr-Pflege, das System der Pflegegrade hilft dabei, den tatsächlichen Bedarf zu erkennen und gezielt zu unterstützen. Wichtig ist: Der Pflegegrad ist nicht „in Stein gemeißelt“. Er kann sich mit der Zeit ändern – je nach Gesundheitszustand. Wer frühzeitig einen Antrag stellt und sich gut informiert, sorgt dafür, dass die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt kommt.
Von Pflegestufen zu Pflegegraden – was sich geändert hat
- Früher gab es nur 3 Pflegestufen, die stark auf körperliche Einschränkungen fokussiert waren.
- Seit 2017 ersetzt ein neues, gerechteres System mit 5 Pflegegraden die alten Stufen.
- Auch Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen erhalten nun leichtere Einstufung und Zugang zu Leistungen.
- Die Einstufung erfolgt nun punktbasiert auf Grundlage von Selbstständigkeit – nicht Pflegeaufwand.
Ihr Pflegegrad steht – jetzt möchten Sie die häusliche Versorgung sicher planen? Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine 24-Stunden-Pflegekraft, passend zu Ihrem Pflegegrad und Budget.

Individuelle Betreuungslösung für Ihr Zuhause
Jede Situation ist einzigartig – wir helfen Ihnen, die passende Betreuungslösung zu finden. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen zur Seite und begleiten Sie auf dem Weg zur optimalen Pflegekraft. Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten.
Kostenlose Beratung sichernDer Weg zur Einstufung in einen Pflegegrad
Die Einstufung in einen Pflegegrad erfolgt in mehreren Schritten und erfordert Zeit und Sorgfalt. Grundlage ist die Prüfung verschiedener Kriterien durch die Pflegeversicherung.
Schritt 1 – Der Antrag: Erstantrag oder Erhöhung
Ein Pflegegrad wird nur auf Antrag bewilligt – sei es bei einer ersten Einstufung oder bei einer beantragten Höherstufung. Dazu genügt zunächst ein formloser Antrag an die Pflegekasse.
Diese sendet daraufhin ein detailliertes Formular zu, in dem Angaben zur pflegebedürftigen Person und ihrem Unterstützungsbedarf gemacht werden müssen. Entscheidend ist das Datum der Antragstellung, da bei Bewilligung Ansprüche rückwirkend ab diesem Zeitpunkt gelten. In dringenden Fällen kann ein Eilantrag gestellt werden, um eine vorläufige Begutachtung binnen 5 oder 10 Tagen zu ermöglichen.
Checkliste: Das brauchen Sie für den Antrag
- Name und Versichertennummer der pflegebedürftigen Person
- Angaben zur aktuellen Pflegesituation
- Arztberichte, Diagnosen oder Krankenhausunterlagen (sofern vorhanden)
- Ggf. Vollmacht für Angehörige
- Ein formloses Schreiben oder Anruf bei der Pflegekasse
Schritt 2 – Das Gutachten: Umfassende Begutachtung zur Ermittlung des Pflegegrads
Im nächsten Schritt beauftragt die Pflegekasse einen Gutachter, der die pflegebedürftige Person in ihrem häuslichen Umfeld besucht. Ziel ist es, den Grad der Selbstständigkeit zu beurteilen und den Pflegebedarf einzuschätzen.
Das Gutachten liefert die Entscheidungsgrundlage, wobei die finale Einstufung der Pflegekasse obliegt. Gegebenenfalls werden ergänzende Unterlagen, wie ärztliche Berichte, hinzugezogen.
Schritt 3 – Der Bescheid: Entscheidung und Widerspruchsmöglichkeit
Das Ergebnis wird in Form eines schriftlichen Bescheids übermittelt, zusammen mit dem Gutachten. Wer mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, kann gegen das Gutachten Widerspruch einlegen.
Hierfür empfiehlt sich eine schriftliche Begründung sowie die Vorlage zusätzlicher medizinischer Nachweise, um die Pflegekasse zur erneuten Prüfung zu bewegen.
25 Tage vom Antrag bis zum Bescheid
Zwischen dem Einreichen Ihres Antrags und dem Erhalt des Bescheides über Ihren Pflegegrad dürfen höchstens 25 Arbeitstage (Montag bis Freitag) liegen. Sollte die Bearbeitungszeit bei der Pflegekasse darüber hinausgehen, haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 70 Euro für jede zusätzliche Woche der Verzögerung.
Die Kriterien für die Einstufung in einen Pflegegrad
Die Erstellung des Pflegegutachtens folgt klar definierten Kriterien. Dabei werden Selbstständigkeit und Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen bewertet, wobei zwischen 0 und 100 Punkten vergeben werden können. Die einzelnen Bewertungen fließen gewichtet in eine Gesamtpunktzahl ein, die schließlich den Pflegegrad bestimmt.
Der Gutachter bewertet unter anderem die Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, das Verhalten, die Selbstversorgung, den Umgang mit Krankheiten sowie soziale Kontakte. Körperliche, geistige und psychische Einschränkungen – etwa bei Demenzerkrankungen – werden dabei umfassend erfasst und unterschiedlich gewichtet in die Gesamtbewertung einbezogen.
Gut zu wissen: Dieses strukturierte Verfahren gewährleistet eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der Pflegebedürftigkeit. Die differenzierte Punktevergabe ermöglicht eine präzise Einschätzung der individuellen Situation und soll sicherstellen, dass Betroffene einem passenden Pflegegrad zugeordnet werden. Sie möchten einschätzen, welcher Pflegegrad realistisch ist und wie sich das auf die 24-Stunden-Pflege auswirkt? Fragen Sie uns – wir ordnen Ihre Situation unverbindlich ein.
Kriterien im Überblick
Die Einstufung in einen Pflegegrad folgt einem modularen Bewertungssystem, ergänzt durch spezielle Kriterien für besondere Lebenslagen:
- Modul 1 (Mobilität): 10% Gewichtung am Gesamtergebnis
- Modul 2 (Kognitive & kommunikative Fähigkeiten*): 15% Gewichtung am Gesamtergebnis
- Modul 3 (Verhaltensweisen & psychische Problemlagen*): 15% Gewichtung am Gesamtergebnis
- Modul 4 (Selbstversorgung): 40% Gewichtung am Gesamtergebnis
- Modul 5 (Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen): 20% Gewichtung am Gesamtergebnis
- Modul 6 (Gestaltung des Alltagslebens & sozialer Kontakte): 15% Gewichtung am Gesamtergebnis
* Modul 2 oder 3 wird je nach individueller Situation gewertet – nicht beide.
Jedes Modul enthält mehrere Fragen, die mit Punkten bewertet werden. Am Ende wird ein Gesamtpunktwert ermittelt, der über den Pflegegrad entscheidet.
Die sechs Module – was genau wird bewertet?
Das Neue Begutachtungsassessment (NBA) gliedert die Bewertung der Pflegebedürftigkeit in sechs Module, die unterschiedliche Lebensbereiche abdecken. Dabei geht es nicht nur um körperliche Einschränkungen, sondern auch um geistige und emotionale Faktoren.
Modul 1: Mobilität
Bewertet wird, wie selbstständig sich eine Person bewegen und ihre Körperhaltung verändern kann – etwa beim Drehen im Bett oder beim Aufstehen. Einschränkungen, die auf geistige Beeinträchtigungen zurückzuführen sind, werden gesondert berücksichtigt.
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
Hier stehen geistige Fähigkeiten im Fokus: Orientierung in Raum und Zeit, Entscheidungsfähigkeit, Gesprächsführung und das Mitteilen eigener Bedürfnisse. Motorische Einschränkungen werden in diesem Modul nicht erfasst.
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Erfasst werden Verhaltensauffälligkeiten und psychische Belastungen wie zielloses Umherlaufen, nächtliche Unruhe oder Wahnvorstellungen, die für Betroffene und Pflegepersonen gleichermaßen belastend sein können.
Modul 4: Selbstversorgung
Dieses Modul misst die Fähigkeit zur eigenständigen Körperpflege, zum An- und Auskleiden, zur Nahrungsaufnahme sowie zur Nutzung der Toilette – zentrale Aspekte der täglichen Selbstständigkeit.
Modul 5: Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen
Hier geht es um die eigenständige Umsetzung ärztlicher Verordnungen, etwa die Einnahme von Medikamenten oder den Umgang mit Hilfsmitteln und Therapien.
Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Bewertet wird, inwieweit die pflegebedürftige Person ihren Tagesablauf selbst plant und soziale Beziehungen aufrechterhalten kann.
Die Punkte – so entsteht der Pflegegrad
Am Ende der Begutachtung errechnet sich aus den Modulen ein Gesamtpunktwert zwischen 0 und 100, der bestimmt, welcher Pflegegrad vergeben wird. Dabei gilt: Je höher der Punktestand, desto stärker ist die Selbstständigkeit eingeschränkt – und desto höher fällt der Pflegegrad aus
Punktetabelle zur Berechnung der Pflegegrade
| Pflegegrad | Punktezahl | Grad der Selbständigkeit |
|---|---|---|
| 1 | 12,5 bis unter 27 | Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |
| 2 | 27 bis unter 47,5 | Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |
| 3 | 47,5 bis unter 70 | Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |
| 4 | 70 bis unter 90 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |
| 5 | 90 bis unter 100 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |
Besondere Regelungen und Sonderfälle
In die Gesamtbewertung fließen nur die wichtigsten Module ein – bei Modulen 2 und 3 zählt jeweils das höhere Ergebnis. Sonderregelungen gelten für Menschen mit Demenz, für Kinder sowie für besonders komplexe Einzelfälle. Hier sorgt eine differenzierte Begutachtung dafür, dass individuelle Bedürfnisse präzise erfasst und angemessen berücksichtigt werden.
Pflegegrade bei Kindern
Pflegebedürftigkeit wird nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern bewertet und in Pflegegrade eingestuft. Kinder mit besonderen pflegerischen Bedürfnissen werden entsprechend der gleichen Kriterien beurteilt, wobei altersgerechte Fähigkeiten und Entwicklungsstufen berücksichtigt werden. So können auch junge Pflegebedürftige die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre Lebensqualität zu verbessern.
Typische Fälle bei Kindern:
- Kinder mit Down-Syndrom
- Frühchen mit neurologischen Folgeschäden
- Kinder mit Diabetes Typ 1 (z. B. bei Bedarf an ständiger Kontrolle)
- Autistische Kinder mit starkem Betreuungsaufwand
Vorteile der Einstufung in einen Pflegegrad
Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und die anschließende Einstufung in einen Pflegegrad bringen zahlreiche Vorteile mit sich – sowohl für die pflegebedürftige Person als auch für deren Angehörige.
Mehr Leistungen durch höheren Pflegegrad
Je nach Pflegegrad stehen unterschiedliche Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung. Ein höherer Pflegegrad weist in der Regel auf einen gesteigerten Unterstützungsbedarf hin – etwa bei der Selbstversorgung oder beim Umgang mit therapiebedingten Anforderungen und Belastungen.
Damit gehen erweiterte finanzielle Leistungen und individuell zugeschnittene Unterstützungsangebote einher. Auch viele Pflegeeinrichtungen orientieren ihr Leistungsangebot am jeweiligen Pflegegrad, was eine passgenauere Versorgung ermöglicht.
Entlastung für pflegende Angehörige
Die Einstufung in einen Pflegegrad bringt auch für pflegende Angehörige spürbare Entlastung. Je nach Pflegegrad können finanzielle Hilfen, Entlastungsleistungen sowie Angebote wie Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden. Diese unterstützen nicht nur bei der täglichen Betreuung, sondern ermöglichen auch dringend benötigte Erholungspausen.
Bessere Planbarkeit und Sicherheit
Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit schafft Klarheit – für alle Beteiligten. Durch die Einstufung in einen Pflegegrad wird ersichtlich, welche Leistungen beansprucht werden können, wodurch sich der Pflegealltag besser organisieren lässt. Die dadurch gewonnene Planbarkeit hilft dabei, notwendige Hilfen rechtzeitig zu beantragen und die Betreuung gezielt auf den individuellen Bedarf abzustimmen.
Der Pflegegrad entscheidet über die Höhe der Leistungen
Je nach Pflegegrad stehen unterschiedliche Leistungen zur Verfügung, die den pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen zugutekommen.
Pflegesachleistungen
| Pflegegrad | Pflegegeld pro Monat |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | - |
| Pflegegrad 2 | 796 Euro |
| Pflegegrad 3 | 1.497 Euro |
| Pflegegrad 4 | 1.859 Euro |
| Pflegegrad 5 | 2.299 Euro |
Hinweis: Bei Pflegegrad 1 gibt es keine Geld- oder Sachleistung, aber dafür andere Unterstützungen.
Grundversorgung bei Pflegegrad 1
Auch wenn Pflegebedürftige erst in Pflegegrad 1 eingestuft sind und somit vergleichsweise wenig Unterstützung benötigen, stehen diesen Basisleistungen der Pflegeversicherung zu. Dabei handelt es sich beispielsweise um Betreuungsleistungen oder Pflegehilfsmittel, die den Alltag erleichtern können.
Leistungen ab Pflegegrad 1
| Leistung | ab Pflegegrad 1 |
|---|---|
| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 Euro |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (monatlich) | 42 Euro |
| Hausnotruf (monatlich) | 25,50 Euro |
| Anpassung am Wohnraum (je Maßnahme) | 4.180 Euro |
Leistungen ab Pflegegrad 2
Ab Pflegegrad 2 haben Versicherte grundsätzlich Anspruch auf volle Leistungen aus der Pflegeversicherung. Dazu zählen zum einen die sogenannten Pflegesachleistungen, die es den Pflegebedürftigen ermöglichen, eine professionelle Pflegekraft zu engagieren. Diese Pflege kann entweder im häuslichen Umfeld oder in speziellen Pflegeeinrichtungen stattfinden. Alternativ dazu steht die Option des Pflegegeldes zur Verfügung.
Dabei erhalten die Pflegebedürftigen finanzielle Mittel, um die Pflege durch eine vertraute Privatperson, meist einen Angehörigen, sicherzustellen. Zudem können teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen sowie vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim von der Pflegeversicherung finanziell unterstützt werden.
Leistungen nach Pflegegraden
| Leistung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld (monatlich) | 0 Euro | 347 Euro | 599 Euro | 800 Euro | 990 Euro |
| Pflegesachleistungen (monatlich) | - | 796 Euro | 1.497 Euro | 1.859 Euro | 2.299 Euro |
| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | - | 689 Euro | 1.612 Euro | 1.612 Euro | 1.995 Euro |
| Vollstationäre Pflege (monatlich) | - | 770 Euro | 1.262 Euro | 1.775 Euro | 2.005 Euro |
| Entlastungsbudget (jährlich) | - | 3.539 Euro | 3.539 Euro | 3.539 Euro | 3.539 Euro |
Pflegegrad-Widerspruch und Beschwerde beim Medizinischen Dienst
Wenn der Bescheid zum Pflegegrad nicht der tatsächlichen Pflegesituation entspricht, sollten Sie einen Widerspruch einlegen und diesen sorgfältig begründen. Häufige Ursachen für fehlerhafte Einstufungen sind:
- Ein besonders guter Tag am Tag der Begutachtung
- Missverständnisse bei der Darstellung des Unterstützungsbedarfs
- Nicht berücksichtigte gesundheitliche Einschränkungen
- Verschlechterung des Zustands nach der Begutachtung
In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Abweichungen schriftlich darzulegen – gestützt durch Pflegetagebuch, Arztberichte oder Stellungnahmen von Pflegepersonen. Ein fundierter Widerspruch kann zu einer erneuten Pflegebegutachtung führen.
Hinweis: Ein Widerspruch ist formlos möglich, muss aber fristgerecht binnen eines Monats bei der Pflegekasse eingehen. Besteht Unzufriedenheit mit dem Vorgehen des Medizinischen Dienstes, kann zusätzlich die regionale Beschwerdestelle kontaktiert werden. Die dort tätige Ombudsperson prüft Beschwerden neutral und hilft bei der Klärung. So lassen sich Missverständnisse aufarbeiten – und die Pflegesituation objektiv neu bewerten. Der Bescheid passt nicht zum tatsächlichen Pflegebedarf? Wir unterstützen Sie beim nächsten Schritt und planen parallel eine 24-Stunden-Pflege, damit die Versorgung gesichert ist.
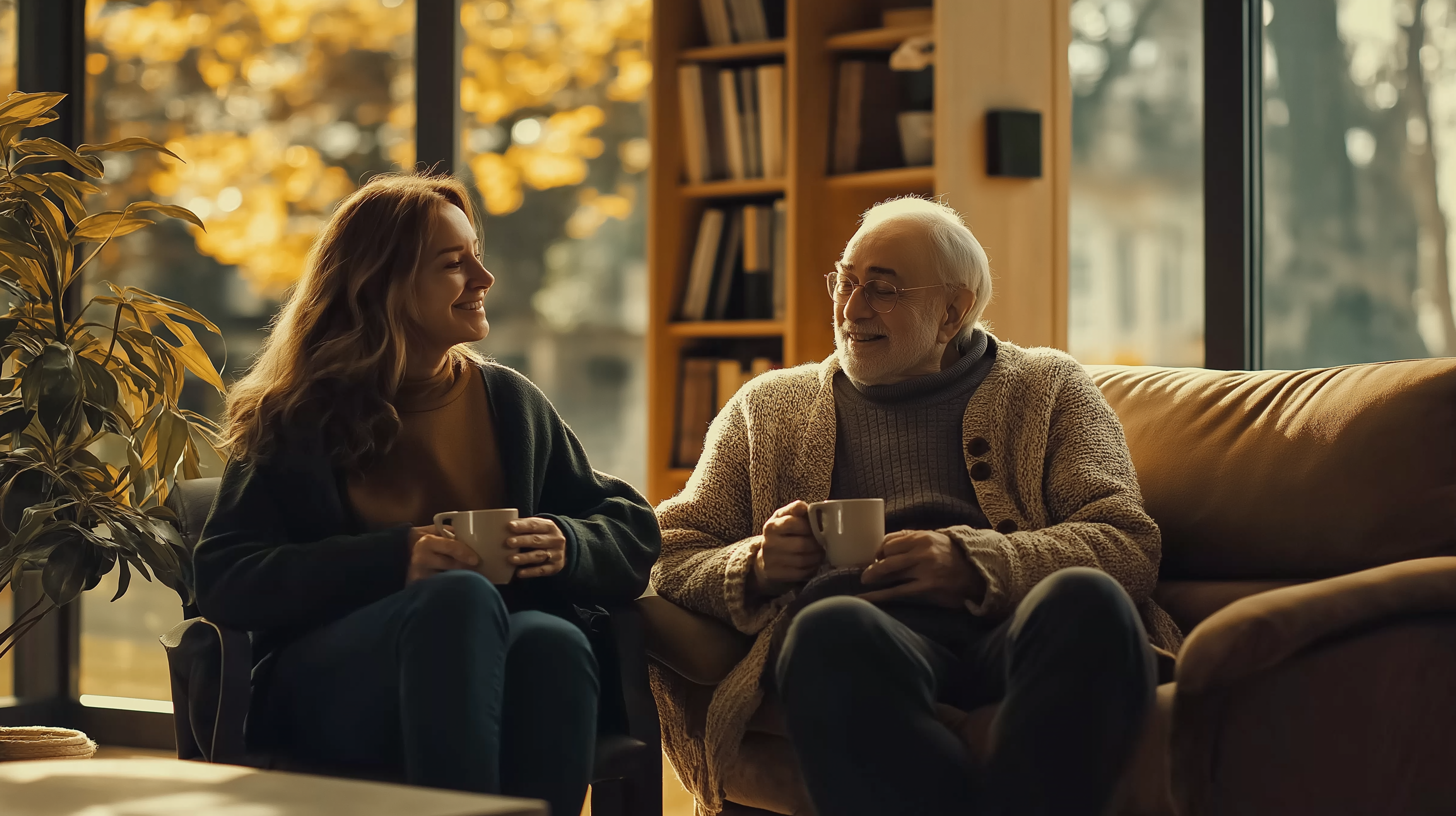
Ihre 24-Stunden-Pflege zu Hause
Suchen Sie eine vertrauensvolle 24-Stunden-Pflegekraft? Wir helfen Ihnen, die passende Betreuung für Ihre Angehörigen zu finden – individuell, liebevoll und kompetent. Entdecken Sie die Vorteile einer Betreuung in den eigenen vier Wänden – sicher, geborgen und ganz nach Ihren Wünschen.
Jetzt Pflegekraft findenFazit: Pflegegrad – ein wichtiger Schritt zu mehr Unterstützung und Sicherheit
Die Einstufung in einen Pflegegrad ist weit mehr als ein formaler Akt: Sie eröffnet Betroffenen gezielt Zugang zu notwendigen Leistungen und schafft Klarheit über die eigene Pflegesituation. Ob es um die Bewältigung des Alltags, den Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen oder die finanzielle Absicherung geht – ein passender Pflegegrad bildet die Grundlage für individuelle Unterstützung.
Gerade bei einer Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen, etwa durch chronische Erkrankungen oder komplexe Pflegebedarfe, ist eine sorgfältige Begutachtung entscheidend. Der Medizinische Dienst spielt hierbei eine zentrale Rolle: Er sorgt mit seinem standardisierten Verfahren für eine bundesweit einheitliche und gerechte Beurteilung der Pflegebedürftigkeit.
Wer gut informiert in das Verfahren geht, Anträge sorgfältig vorbereitet und gegebenenfalls von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch macht, kann sicherstellen, dass die eigene Situation richtig erfasst wird – und damit die passende Hilfe erhält, um den Alltag weiterhin bestmöglich zu gestalten.








